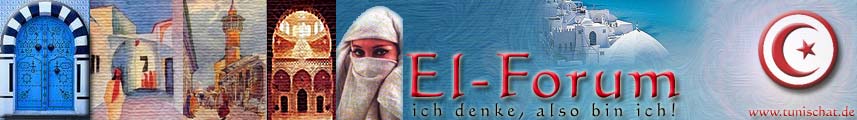guten morgen nochmal an alle..
diesen Artikel hab ich vorhin gelesen, er hat mich zugeleich traurig und nachdenklich gestimmt. ich es ist eine Art beschreibung von einem interview, das mit 2 Menschen geführt wurde, die vor 10 jahren im Völker mord in Ruanda aktiv beteiligt waren. sie haben ehrlich über das berichtet was in ihnen vorging als sie auf die meschen los schlugen. das erinnerte mich an den Joguslavien Krieg 1992, denn auch da waren es menschen die ewig zusammenlebten, bis sie irgendwann merkten sie seien doch nicht gleich, was allerdings kein grund sein sollte alles zu töten was nicht "gleich" ist.. die bewegründe der massaker sind einfach und logisch erklärt, die gefühle dabei wird denk ich fast jeder wieder erkennen wenn er ehrlich zu sich ist.. doch normale menschen, die nachdenken, wissen mit solchen gefühlen umzugehen und sie in richtigere bahnen zu lenken, was diese beiden nicht taten.. hier der etwas lange Artikel, doch lesenwert ..
06. April 2004 "Es war wie ein Rausch. Ich tötete, tötete und tötete." Besuch im Gefängnis von Kimirongho, Kigali: Laurent, ein drahtiger Mann mit freundlichen Augen. Vor dem Genozid war er Viehhirte. Nur selten interessiert sich jemand für Laurents Geschichte, die doch so typisch ist für das, was vor zehn Jahren im Land der tausend Hügel seinen blutigen Auftakt nahm. Und nur selten gelingt es Ausländern, mit den Mördern von einst reden zu können.
Am 6. April 1994 wird das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Habyarimana von unbekannten Tätern über der Hauptstadt Kigali abgeschossen. Es ist der Beginn des effizientesten Genozids im zwanzigsten Jahrhundert: In weniger als hundert Tagen werden vor den Augen der Weltöffentlichkeit 800.000 bis eine Million Menschen, vorwiegend Tutsi, mit Macheten und Nagelkeulen niedergemetzelt. Die Täter sind Hutu, die mit ihren Opfern jahrzehntelang Tür an Tür den Alltag teilten. Erst der Vormarsch der aus Uganda einrückenden Ruandischen Patriotischen Front (RPF) bereitet am 4. Juli dem Blutbad ein Ende. "Ich hörte im Radio vom Abschuß des Flugzeugs und war wie vor den Kopf gestoßen", erinnert sich Laurent. "Die Moderatorin sagte, daß keiner sein Haus verlassen darf."
Die Armut zwingt zum gemeinsamen Alltag
Verlegen streicht er über seine rosafarbene Gefängniskleidung, die den Häftlingen den Beinamen "Flamingos" eingebracht hat. Seit sieben Jahren ist er inhaftiert; er bekennt sich des Mordes an achtzehn Tutsi schuldig. Das Gefängnis ist ein ehemaliger Busbahnhof, der 1994, als die ruandischen Gefängnisse die Flut der Täter nicht mehr zu fassen vermochten, umfunktioniert wurde. Der Ort erstickt in menschlicher Enge: 6.283 Menschen teilen sich zwei Dutzend Latrinen. Geschlafen wird in Zeltbaracken, die der Regen knöcheltief unter Wasser setzt. Die Gefangenen leiden an Rheuma, Typhus und Aids. Wachpersonal gibt es kaum, aber fliehen will hier keiner. Der Weg ins Ausland ist zu teuer, zu Hause droht die Rache der Überlebenden, und zu essen gibt es draußen weniger als hier, wo das Internationale Rote Kreuz die Lebensmittelversorgung organisiert.
Die ruandische Gesellschaft ist zehn Jahre nach dem Völkermord tief gespalten. Viele Schuldige leben noch immer auf freiem Fuß, und dennoch sind die Gefängnisse des Landes mit 80.000 Männern und Frauen hoffnungslos überfüllt. Präsident Kagame, 1994 Befehlshaber der RPF, vertritt eine Politik der Versöhnung: Die Toten sind begraben. Auch am zehnten Jahrestag des Genozids, wird er wieder davon sprechen. Aber fast keine Familie, die nicht ein Opfer zu beweinen oder einen Täter zu verschweigen hat. Man mißtraut einander. Doch die Armut zwingt zum gemeinsamen Alltag: acht Millionen Einwohner auf einer Gesamtfläche so klein wie das Land Brandenburg.
Es gab keine Konflikte, die Nachbarn nicht auch andernorts hätten
Wie war das Zusammenleben vor dem Genozid? Laurent windet sich: "Ich muß zugeben, in meiner Nachbarschaft gab es damals viele Tutsi. Wir hatten keine Probleme, besuchten uns, und ich spielte Fußball mit den Jungs. Einige von ihnen habe ich später getötet." Eine Aussage, die sich wie ein roter Faden durch die Gespräche mit Tätern und Opfern zieht: keine Konflikte, die Nachbarn nicht auch andernorts hätten. Hutu und Tutsi heiraten untereinander, bewirtschaften gemeinsam die Felder, und abends lädt man sich auf ein Bier ein - dann plötzlich das Blutbad; drei Viertel der Tutsi-Bevölkerung werden auf bestialische Weise abgeschlachtet. Aus dem Nichts?
Fest steht: Der Genozid war der vorläufige Höhepunkt einer gezielten politischen Dichotomisierung von Hutu und Tutsi. Dies hätte von ausländischen Beobachtern bemerkt werden können. Statt dessen übernahm die Weltöffentlichkeit die offizielle Interpretation der Hutu-Drahtzieher und legte die Massaker als Resultat eines seit Jahrhunderten schwelenden Konfliktes zwischen Hutu und Tutsi aus. Ein Grund also, um sich laut UN-Charta eine bewaffnete Intervention zu versagen.
Eskalation zum Völkermord
Doch welche politischen Interessen standen hinter dem Genozid? Im Oktober 1990 wird Ruanda von der von Tutsi dominierten Ruandischen Patriotischen Front (RPF) angegriffen. Ziel der Invasion ist, der politischen Diskriminierung der Tutsi ein Ende zu bereiten. Der Angriff betrifft zwar nur den Nordosten des Landes, hat aber verhängnisvolle Folgen für die gesamte ruandische Gesellschaft. Um ihre Macht zu sichern, gründen Hintermänner des Hutu-Präsidenten Parteien, die das aggressive Erfolgskonzept bisheriger politischer Konflikte in Ruanda kopieren: die ethnische Segregation. Vor allem der Hörfunk in Gestalt des Radiosenders "Mille Collines" beteiligt sich mit durchschlagendem Erfolg an der Parteienpropaganda und erreicht die breite Masse der weitgehend analphabetischen Landbevölkerung. In der Sprache des Radios sind die Soldaten der RPF "Kakerlaken", die schnell mit den ruandischen Tutsi gleichgesetzt werden. Ein Kontingent von 2.500 Blauhelmsoldaten unter dem belgischen General Dallaire soll Sicherheit garantieren. Doch dann wird das Flugzeug des Präsidenten abgeschossen.
In Laurents Heimatregion Gitarama bleibt bis zum 14. April alles ruhig. Denn die Täter der ersten Stunde, Regierungssoldaten und Parteimilizen, konzentrieren sich zunächst auf die Hauptstadt Kigali. Dort werden neben Tutsi auch Hutu der Opposition getötet. Die über das Radio verhängte Ausgangssperre erleichtert den Tätern ihr grausames Handwerk. Erst vom 12. April an breitet sich die Gewalt auf das Umland aus. Nun soll sich jeder an dem Morden beteiligen. Das Ziel: eine neue nationale Identität, die das Volk in dem Erlebnis des gemeinsamen Mordens vereint. "Ob Frauen, Mädchen, Männer, wir alle müssen für Ruanda kämpfen", skandiert Radio "Mille Collines".
Schrittweise in die Gewalt abgeglitten
Laurent gestikuliert. "Natürlich hatte ich Angst vor dem, was man im Radio sagte, aber ich hätte nie gedacht, daß der Krieg uns hier erreicht!" Doch dann nimmt die Situation einen für die Ereignisse in Ruanda typischen Verlauf: Der Bürgermeister versammelt das Dorf. Vereint soll gegen die "Kakerlaken" gekämpft werden. "Wir wußten, daß mit Kakerlaken die RPF-Soldaten und ihre Komplizen gemeint sind. Wie wußten auch, daß wir Tutsi-Nachbarn haben. Aber daß das ein und dasselbe ist, das wußten wir bis dahin nicht." Als Indiz werden ugandische Briefmarken eines Tutsi herumgereicht. Die Papierfetzen genügen, um den Betreffenden für Laurent als Informanten der in Uganda stationierten RPF zu entlarven. Die drückende Last der scheinbaren Beweise, die aufpeitschenden Hetzaufrufe des Radios ohne andere Informationsquellen sowie der anerzogene Autoritätsgehorsam der Bevölkerung schaffen den Rahmen, in dem er und die übrigen Dorfbewohner nun schrittweise in die Gewalt abgleiten.
Um verdächtige Tutsi an der Flucht zu hindern, errichten sie gemeinsam eine Straßensperre. Zunächst passiert nichts. Langeweile macht sich breit, nur das Radio sorgt mit Live-Berichten von Massakern für Unterhaltung. Am 16. April zerrt der Bürgermeister schließlich einen jungen Tutsi an die Straßensperre und fordert die Dorfbewohner auf, ihre Pflicht fürs Vaterland zu erfüllen. Man zögert; der angebliche RPF-Komplize ist im ganzen Dorf beliebt. Doch dann schlägt einer zu, und die anderen fallen ein; erst mit Fäusten, dann mit der Machete; Laurent mit einer Nagelkeule.
Das Wort des Bürgermeisters
Rückblickend macht er das Wort des Bürgermeisters für diesen ersten Mord verantwortlich: "Eine Autorität, das ist in Ruanda wie ein Elternteil, den man respektieren muß. Ich fühlte, ich muß akzeptieren, was er sagt, denn der Bürgermeister ist das Gesetz." Ähnlich beschreibt Olivier, ein Häftling aus der Region Bicumbi, gut neunzig Kilometer von Gitarama entfernt, die Eskalationsstufen der Gewalt: Er zweifelt an der Berichterstattung des Radios, bekommt aber große Angst. Als dann der Dorflehrer ihm eine Woche nach Absturz des Präsidentenflugzeugs "Beweise" gegen seinen Tutsi-Nachbarn vorlegt, schlägt er diesen mit seiner Machete nieder. "Nachdem ich den ersten getötet hatte, war alles anders. Wenn mir jemand sagte, einer sei Tutsi, dann war es vorbei für mich: Er mußte sterben."
Hätten die beiden Männer damals noch aufgehalten werden können? Olivier hebt fragend die Schultern: Von wem denn? Am 21. April erklärt Dallaire dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, daß er den Massakern mit fünftausend bis achttausend Mann Einhalt gebieten könnte. Dennoch wird seine Truppe auf 270 Blauhelmsoldaten reduziert. Man möchte kein Risiko eingehen. Zu frisch sind die Fernsehbilder aus Somalia 1993, wo amerikanische Soldaten von der aufgebrachten Menge gelyncht wurden. Am 30. April verurteilt der Sicherheitsrat die Massaker in Ruanda, lehnt jedoch eine militärische Intervention ab. Zu diesem Zeitpunkt hat Olivier bereits sieben Menschen getötet. Der einzige Hubschrauber, der dabei über ihm kreist, ist der eines ausländischen Fernsehteams.
Das Allmachtsgefühl, über Leben und Tod entscheiden zu können
Die Erinnerung an die Tage nach dem Initialmord fällt den beiden Männern schwer, die Erzählungen vermischen sich zu einem Brei aus Blut und Gewalt. "Es war, als sei Satan in mich gefahren", versucht Olivier das Unfaßbare für sich begreiflich zu machen. Beide Männer schlagen unabhängig voneinander den verhängnisvollen Weg ein, den, so jüngste Schätzungen, siebzig Prozent der Hutu-Bevölkerung damals gehen: Täglich machen sie sich auf die Jagd nach Tutsi: erst auf die Männer, dann auf die Frauen und schließlich auch auf deren Kinder. Gegenwehr gibt es kaum, denn die Gejagten sind in der Minderheit und vertrauen zu lange auf gute Nachbarschaft. Die Gruppe der Mörder ist die neue Familie der Täter. Sie schlafen, essen, töten und vergewaltigen gemeinsam.
Der Zusammenhalt verpflichtet und dynamisiert das Geschehen. "Wenn man zu dritt ist und zwei zuschlagen und der andere ist nicht sofort tot", erklärt Laurent, "dann fühlst du dich verpflichtet mitzumachen. Denn man tötet einen Feind, und wenn es den beiden nicht gelingt, dann mußt du eingreifen." Waren da anfangs noch leise Zweifel, sind diese verflogen: Die Idee zu töten bestimmt das Handeln und treibt die beiden Männer an. Es herrscht eine Atmosphäre der Straflosigkeit und das Allmachtsgefühl, über Leben und Tod entscheiden zu können. Olivier wendet sich ab: "Du mußt suchen, du mußt finden, du mußt töten ... Erst dann wird man wieder ruhig, weil man fühlt, daß die Arbeit, die man machen muß, erledigt ist."
Zehn Jahre nach dem Völkermord arbeitet die ruandische Justiz, geschwächt durch die Ermordung von zahlreichen Richtern und Staatsanwälten, nur schleppend. Der in Tansania eingerichtete Kriegsgerichtshof der Vereinten Nationen kümmert sich nur um die wenigen Angeklagten, die im Ausland gefaßt werden - zumeist sind es Drahtzieher. Die große Masse der Täter wartet hingegen bis heute auf ein Gerichtsverfahren. So auch Laurent und Olivier. Ihnen droht lebenslänglich, was in Ruanda kaum schreckt: Aus Platzmangel werden die Gefangenen meist bald entlassen. Laurent lächelt: "Jetzt, wo ich gestanden habe, kann ich vielleicht bald mit einem Richter sprechen, und dann möchte ich mich entschuldigen." Entschuldigen. Ein schöner Gedanke. Doch bei wem?
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt." by Albert Einstein









 Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden
Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden
Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden