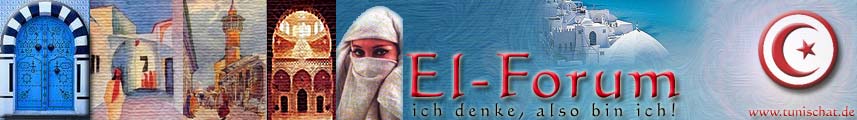Salam alleikum
Nun wie wie alle wissen steht es, in den meisten arabischen Staaten, mit der Pressefreihiet nicht zum besten, was noch sehr milde ausgedrückt ist. In der Regel herrscht in den einzelnen Staaten eine staatliche Zenzur und unterbindet damit den kritischen Journalismus.
Doch in den letzten Jahren werden, die einst leisen Rufe, zu einer freieren Berichterstattung immer lauter.
Der erste Schritt in diese Richtung war unstrittig mit der Gründung des arabischen Senders Al Jazeera getan.
Im Februar 1996 gründete der Emir von Katar, Scheich Hamad bin Khallifa Al Thani, per Dekret den staatlich unabhängigen Fernsehsender Al Jazeera. Mit einem Startkredit in Höhe von circa140 Millionen US-Dollar1 (vgl.: El-Nawawy/ Iskandar 2002) sicherte der Emir den Sendebeginn am 1. November 1996 und die folgenden fünf Jahre finanziell ab. Danach sollte sich Al Jazeera selbst tragen und sich aus Werbeeinnahmen finanzieren. Für ein demokratisch geprägtes Verständnis von Medienfreiheit klingt diese Gründungsgeschichte sicher merkwürdig. Doch in der arabischen Welt war sie der Beginn einer Medienrevolution und Katar konnte sich dadurch Gehör in der Welt verschaffen. 1995 übernahm Al Thani per „sanften“ Putsch die Macht von seinem Vater und bemühte sich von da an das Land in kleinen Schritten zu modernisieren und zu demokratisieren. Neben der für 2003 angekündigten Parlamentswahl und dem gewählten „consultative council“ weisen vor allem Veränderungen in der Medienlandschaft Katars auf die liberalere politische Einstellung des Emirs hin. So verringerte er 1995 den Einfluss der Pressezensur und schaffte das Informationsministerium ab. Diese staatliche Stelle war bis dato für die Zensur verantwortlich, betrieb Radio- und Fernsehstationen und legte die Qualitätsstandards für die lokale Presse fest. Außerdem überwachte das Ministerium ausländische Journalisten und Wissenschaftler bei deren Recherche im Land (vgl.: El-Nawawy/ Iskandar 2002). Für Al Jazeera untersagte der Scheich jegliche staatliche Einmischung in die Sendegestaltung. Demgemäß widerstand er bisher dem Druck arabischer Regierungen und auch dem der US- Administration der kritischen Berichterstattung des Senders Einhalt zu gebieten. Die Gründung Al Jazeeras steht daher im Einklang mit der Vision des Emirs, eine liberale Gesellschaft mit freien Medien in seinem Land aufzubauen. Dennoch unterscheidet sich die Medienfreiheit noch immer von westlichen Standards. So ist z.B. Kritik an der Herrscherfamilie und am Islam untersagt. Zudem sind Fernseh- und Radiostationen noch immer staatlich und werden von offizieller Seite kontrolliert. Nur Al Jazeera ist privatwirtschaftlich organisiert und kann unabhängig agieren.
von: Ellen Dietzsch
Doch ist trotz dieses renomierten Senders die Situation arabischer Journalisten und der freien Presse mehr als schlecht.
Kritische Berichte werden von den Regierungen untersagt, geschweige denn wie im Fall von Al Jazeera gefördert.
Doch werden in jüngster Zeit auch Themen kritisch disskutiert, die man vor geraumer Zeit noch unter den Tepisch hätte kehren wollen.
Nun ist dies ein Zeichen eines Wandels zu verstehen ?
Ist es vielleicht nur eine temporäre Begleiterscheinung des Terrors der die Welt umhüllt ?
HAbe hierzu einen kleinen Bericht entdeckt...
Wie arabische Medien den Terror diskutieren
Gegen Terroristen mit Enthauptungsvideos kommen arabische Intellektuelle und Journalisten in der internationalen Wahrnehmung nicht an. Doch im Schatten dieser Horrorbilder findet in arabischen Zeitungen eine ernsthafte Debatte über die Ursachen des Terrors statt. Ausfälle gibt es freilich auch.
Berlin - Ja, sagt Ali Ibrahim im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE, der Kommentar seines früheren Chefredakteurs habe schon für ungewöhnlich viele Leserreaktionen gesorgt. Er sei ja auch provokativ gewesen.
Das kann man wohl sagen: Der Diskussionsbeitrag, der am 3. September in der arabischen Zeitung "al-Sharq al-Awsat" gedruckt worden war, trug die Überschrift "Die schmerzhafte Wahrheit ist, dass alle Terroristen Muslime sind".
In Raschids Abrechnung mit dem arabisch-islamischen Terrorismus stand unter anderem: "Die Entführer der Kinder in Ossetien sind Muslime. Die Entführer und Mörder der nepalesischen Köche und Arbeiter (im Irak) sind Muslime. Die Eindringlinge und Mörder in Darfur sind auch Muslime, genau wie ihre Opfer. Die Angreifer ziviler Einrichtungen in Riad und Khobar (in Saudi-Arabien) waren ebenfalls Muslime. Die Kidnapper der beiden französischen Journalisten (im Irak) sind Muslime. Die beiden Hijacker, die vor einer Woche zwei russische Flugzeuge gesprengt haben, waren Muslime. Bin Laden ist Muslim."
Offenbar, so Raschid, sei die arabisch-islamische Gesellschaft an ihrem Rand von einer Art Krankheit infiziert. "Und wir müssen einsehen, dass wir den Zustand unserer Jugend, die solche schrecklichen Verbrechen begeht, nicht heilen können, ohne dass wir auch das Denken unserer Scheichs verändern, die (...) anderer Leute Kinder in den Krieg, ihre eigenen aber auf Schulen in Europa und Amerika schicken."
"Eine gesunde Diskussion"
Man kann sich vorstellen, warum viele der rund 400.000 Leser von "al-Sharq al-Awsat" empört und verletzt reagierten. Der Autor hatte nicht eine Zeile auf künstliche Rechtfertigungen des Terrors verschwendet, sondern ihn als durch und durch unentschuldbar beschrieben. Keineswegs allerdings seien alle Zuschriften negativ gewesen, betont Ali Ibrahim. Es habe auch eine Menge Zustimmung für Raschid gegeben. "Eine gesunde Diskussion", nannte Raschid deshalb seinen heutigen Beitrag in dem in London erscheinenden Blatt, in dem er auf die Zuschriften einging.
Die Kontroverse um Raschids Kommentar zeigt, dass es auch in der arabisch-islamischen Welt eine ernsthafte Debatte über die Ursachen des islamistischen Terrors gibt. Freilich ist es kein Problem, an einem gegebenen Tag in einem arabischen Land einen Zeitungsartikel zu finden, in dem der israelische Geheimdienst sämtlicher Terroranschläge dieser Welt bezichtigt wird. Und natürlich ist es beileibe nicht so, dass die Presse in den 22 arabischen Staaten frei ist und schreiben dürfte, was sie wollte. Aber: Die staatliche Kontrolle sei lockerer geworden, meint zum Beispiel Ali Ibrahim. Und mit Sicherheit gibt es heute auch an jedem beliebigen Tag Betrachtungen zum islamischen Terror, die es wert wären, auch im Westen gelesen zu werden.
"Rückkehr in die Steinzeit"
Ob nach den Anschlägen vom 11. September, denen von Bali oder denen in Riad: Stets fanden sich Artikel in der arabischen Presse, die den Terror eindeutig und unmissverständlich verurteilten. Von einer "Rückkehr in die Steinzeit" oder einem "kriminellen Massaker" schrieben die Kolumnisten nach dem Terroranschlag in Madrid im März dieses Jahres. Keineswegs ist es also so, dass erst die Bilder der geschundenen und gequälten Kinder der Geiselnahme in Ossetien die arabische Presse zu einer eindeutigen Ablehnung des Terrorismus gebracht hätten, wie es zuletzt einige westliche Journalisten vermuteten.
Einhellig ist die Verdammung des Terrorismus allerdings nie. Immer wieder gibt es extrem antisemitische Artikel nach größeren Anschlägen; insbesondere die islamistische Presse in Ägypten hält sich mit Verschwörungstheorien kaum zurück. Das "Middle Eastern Media Research Institute" listet unter memri.de regelmäßig solche unappetitlichen Hetzartikel auf. Dass sie erscheinen können, spricht weniger für die Pressefreiheit als vielmehr dafür, dass bestimmte Chefredakteure kein Interesse daran haben, Angriffe auf "die Juden" und Israel zu unterbinden.
Ehrliche Selbstkritik nimmt zu
Zwar ist die ehrliche Betrachtung der Zustände in der arabischen Welt noch nicht allgemeines Gedankengut, ihr wird aber zweifellos immer mehr Platz eingeräumt. "Auch die Araber tragen eine Verantwortung für die Ermunterung der Mudschahidin in Tschetschenien", schrieb gestern beispielsweise der Kolumnist Ghassan al-Imam in "al-Sharq al-Awsat". Sie sollten aufhören, die Terroristen ideell oder finanziell zu unterstützen, denn deren Vorgehen schade den Muslimen in der Welt. Außerdem müsse "die Unmöglichkeit, den Tschetschenen die Unabhängigkeit zu erteilen", erkannt werden - eine deutliche Ablehnung des islamistischen Topos von einem dort zu errichtenden islamischen Staat.
Auch Redakteur Ali Ibrahim hat die Herausforderung angenommen, sich nicht vor der Frage zu drücken, wieso die arabische Gesellschaft Terroristen gebiert. In einem Kommentar stellte er gestern die Frage: "Wie ist es möglich, dass ein Mensch einen derartigen Grad an (moralischem) Verfall erreicht?" Die radikale Ideologie sei Teil der Erklärung, reiche aber alleine nicht aus. Forscher und Psychologen sollten diesen Fragen endlich nachgehen, fordert Ibrahim.
Und der ägyptische Journalist Wael al-Abrashi nahm im Juni vergangenen Jahres ebenfalls kein Blatt vor den Mund, als er den Wahhabismus, die in Saudi-Arabien verbreitete Spielart des Islams, als Grundlage des Terrorismus beschrieb: "Der Wahhabismus ist unfähig, die Werte der Toleranz zu verbreiten, für die der Islam steht."
Steinchen im Kaleidoskop
Freilich ist es für einen Ägypter leichter, die saudische Regierung als seine eigene anzugreifen, genau wie es für einen Saudi nicht verfänglich ist, den Qaida-Terror gegen Ausländer im eigenen Land zu verurteilen, solange er das Königshaus aus seiner Kritik auslässt. Erst die Zusammenschau der gesamten arabisch-sprachigen Presse vermittelt also ein deutliches Bild. Die Presse eines Landes allein ist nicht mehr als ein Steinchen in einem Kaleidoskop.
Als einen bedeutenden Faktor für die Radikalisierung der Islamisten betrachten viele Autoren im Übrigen seit Jahren übereinstimmend die Methode des "Takfir". Dieser islamrechtliche Vorgang bedeutet, dass jemand zum Ungläubigen und damit für vogelfrei erklärt wird. Erst durch die massenhafte Anwendung des Takfir, der unter Islamisten in den Achtzigern zur Mode wurde, sei die Brutalisierung der Mudschahidin möglich geworden - plötzlich war nichts mehr einfacher, als das Leben des Gegners für wertlos zu erklären.
Imame und Rechtsgelehrte, die diesem Prinzip noch immer das Wort reden, werden deshalb regelmäßig von den arabischen Printmedien attackiert. "Jeder, der Takfir-Ideologie praktiziert und für seine eigenen Zwecke nutzt, wird in ihrem Feuer verbrennen, denn niemand kann sie kontrollieren", fasst der Ägypter al-Abrashi zusammen.
Das Netz gehört den Radikalen
Die radikalen Islamisten betreiben ihrerseits auch Zeitungen. Immer stärker aber nutzen sie insbesondere das Internet. Zu Tausenden loggen sich Islamisten aus der gesamten Welt Tag für Tag in einschlägigen Internetforen ein und bejubeln die Gräueltaten der Mudschahidin im Irak oder in Tschetschenien. Bekennerschreiben und Strategiepapiere der al-Qaida und verwandter Organisationen werden begeistert weitergereicht und mit Kommentaren versehen, Links zu noch radikaleren Seiten getauscht, gefallene Kämpfer betrauert und verherrlicht.
In diesem Umfeld tauchen denn auch regelmäßig die grauenhaften Enthauptungsvideos aus dem Irak oder die Terrordrohungen der al-Qaida auf - und werden, naturgemäß, im Westen sofort zur Top-Nachricht. Es liegt auch an diesem blutigen Hintergrundrauschen, dass die arabischen Printmedien international kaum wahrgenommen werden.
Dabei seien in Wahrheit 99 Prozent der Muslime gegen den Terror, schätzt Ibrahim. Langfristig werde dies auch noch deutlich werden. Denn die arabischen Gesellschaften, ist er sich sicher, verlange es nach immer mehr Offenheit und Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung mit ihren Problemen. Arabische Journalisten haben schon längst begonnen, diesen Anspruch auf ihre Art zu spiegeln: Immer öfter fordern immer mehr von ihnen eine Qualitätsoffensive für die Medien zwischen Casablanca und Medina.
von : Yassin Musharbash

-------------------
Peace and out
-------------------
 Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden
Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden
Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden